20879 BG
Die Motivation dieses Projektes war die ökologisch nachhaltige und energieeffiziente Nutzung von Brauereistoffen. Ziel war es, Biertreber und Bierhefe als Adsorbens zur Entfernung von Eisen-, Sulfat-, Zink- und Manganionen aus Grund- und Oberflächenwässern einzusetzen. Dazu wurde Treber erstmalig ohne Verwendung von organischen Lösungsmitteln verestert, wodurch sein Potential zur Mangan(II)- und Methylenblauadsorption erheblich gesteigert werden konnte. In weiteren Untersuchungen wurden die Reaktionsparameter mittels statistischer Versuchsplanung systematisch optimiert. Auf Basis dieser Erkenntnisse wurde eine mechanochemische Modifikation in einem Kugelmühlenreaktor konzipiert und ein Reaktionssystem konstruiert, dass die Modifikation als „Eintopfverfahren“ in der Feststoffphase realisiert und damit Energie, Verfahrensschritte und Reaktanden einspart. Im Anschluss wurde ein Konzept zur Aufreinigung entwickelt, das residuale Störstoffe des Trebers mittels Heißwasserextraktion entfernt und die Phasen konsekutiv in einer Dekanterzentrifuge trennt. Dieses Kombinationsverfahren zeigt ein hohes Potential zur Aufreinigung und Fest/Flüssig-Trennung. Durch den geringen Apparateeinsatz ist eine gute Integration in den Brauereibetrieb möglich. Mit den Erkenntnissen und weiterführender Forschung können künftig Brauereistoffe als Absorptionsmittel in der Wasseraufbereitung eingesetzt werden.
Bearbeitet wurde das Forschungsthema von 10/19 bis 09/22 an der Technische Universität München, Wissenschaftszentrum Weihenstephan, WZW, Lehrstuhl für Lebensmittelchemie und Molekulare Sensorik (Lise-Meitner-Straße 34, 85354 Freising, Tel.-Nr. 08161-712356) unter der Leitung von Dr. Karl Glas (Leiter der Forschungseinrichtung Prof. Dr. Th. Hofmann) und dem Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e.V. (Hohe Str. 6, 01069 Dresden, Tel. 0351/4658-232) unter der Leitung von Dr. S. Schwarz (Leiter der Forschungseinrichtung Prof. Dr. B. Voit).
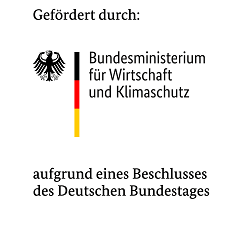 Das IGF-Vorhaben Nr. 20879 BG der Forschungsvereinigung DECHEMA, Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V., Theodor-Heuss-Allee 25, 60486 Frankfurt am Main wurde über die AiF im Rahmen des Programms zur Förderung der industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.
Das IGF-Vorhaben Nr. 20879 BG der Forschungsvereinigung DECHEMA, Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V., Theodor-Heuss-Allee 25, 60486 Frankfurt am Main wurde über die AiF im Rahmen des Programms zur Förderung der industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.